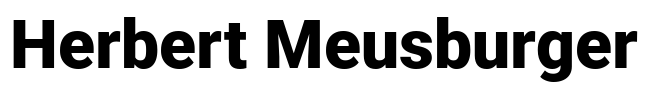Der Bildhauer Herbert Meusburger zerlegt massive Gesteinsbrocken in einzelne Teile, um sie, formal und inhaltlich anders gewichtet, wieder zu einer Einheit zu ver- schmelzen. Er lässt rohes Material parallel zu fein geschliffenen Elementen Raum greifen. Er baut harte Widerstände, Wälle, Blockformationen, seriell angelegte skulpturale Formate und im Ausgleich dazu bildhauerische Mäßigungszonen, Ruhepole. Der Künstler arbeitet klassisch und modern zugleich. Mit einem Material, Stein, das widersprüchlich sein mag, antiquiert und zeitgenössisch gleichermaßen, leicht und schwer, archaisch unverrückbar und dennoch durchlässig.
Die künstlerischen Ursprünge Meusburgers liegen allerdings im Holz begründet. Schon als Fünfzehnjähriger besuchte er die Schnitzschule Elbigenalp in Tirol (1968 bis 1972). Etliche Jahre schnitzte er ländliche und religiöse Motive. Leben konnte er gut davon. Schweizer Sammler und Souvenirjäger standen vor seinem Schnitzatelier Schlange.
Erst 1980 entstanden die ersten Arbeiten in Stein. Ein radikaler Bruch mit der Holzschnitzkunst erfolgte. Für Meusburger brach sozusagen das „Steinzeitalter“ an. Zunächst sammelte er in Gebirgsbächen und alpinen Zonen Steine und polierte nur die dem Gestein innewohnenden Eigenheiten heraus: Farbadern, Ausspülungen, formale Besonderheiten. Zu den Ausstellungen präsentierte er monumentale Gletscherschliffe und Findlinge neben stärker bearbeitetem Kleingestein. Diese Arbeiten wurden von der Auffassung getragen, das Material So weit wie möglich unbearbeitet und für sich selbst sprechen zu lassen.
In den 1990er Jahren wurden die direkten gestalterischen Eingriffe in das Material zusehends evidenter. Das Gestein wird jetzt bis zu einem gewissen Grad seiner Eigendynamik beraubt und dem gestalterischen Willen des Künstlers unterjocht. Meusburger entwickelt Stelen aus Granit und Serpentin, zaunartige Gebilde in Stein, „Behausungen“ sowie seriell aufgebaute Formationen wie etwa die „Body-Buildings“ – eine 96-teilige monumentale Gemeinschaftsarbeit mit der oberösterreichischen Bildhauerin Gabriele Berger, die in den 1990er Jahren in der Feldkircher Innenstadt, im öffentlichen Raum Amstettens sowie auch im Offenen Kulturhaus (OK) in Linz in verschiedenen Installationsanordnungen zu sehen war.
Meusburger beginnt, die Abstraktheit des Materials mit gesellschaftskritischen Bezügen inhaltlich zu verschränken und aufzuladen. Die Skulpturen erinnern in ihrer neuen Ausprägung an Architekturlandschaften wie Brücken, Stege oder Überführungen, ganz im Sinne von „Verbindungen“. Andererseits signalisieren schroffe, zer- klüftete Säulen und Gesteinsrelikte Bezüge zu Begriffen wie Isolation, Trennung und Zerstörung. Von der Materialbehandlung her kontrastieren grobbelassene Oberflächenstrukturen zu großflächig polierten Zonen und aus enggesetzten Meißelschlägen erwachsene Ornamentalbereiche. Wilde Schroffheit steht in Opposition zu versöhnlicher Anschmiegsamkeit. Es geht dem Bildhauer nicht mehr darum, im Stein Verborgenes freizulegen, wie dies bei den klassischen Bildhauern der Fall war und ist, sondern das Material als Basiselement für den Transport gestalterisch-konstruktiver Konzepte einzusetzen. In der jüngsten Vergangenheit ist im Werk Meusburgers eine Neigung zu beobachten, die zu einer noch strengeren architektonischen Grundauffassung überleitet. Dessen ungeachtet sind auch die jüngeren skulpturalen Formationen des Bildhauers in einer analogen Kongruenz zu seiner künstlerischen Philosophie des Trennens und Verbindens zu sehen.
Dieser Philosophie entsprechend, bei der es um Stützen und Lasten, Aufrauen und Glätten sowie um Abspalten und Zusammenfügen geht, hat Meusburger eine eigene Formalsprache erarbeitet, die an die Konstruktionsweisen alpiner Block- und Almhüttenarchitekturen erinnert. Seine vielteiligen Objekte verkörpern quasi modellhafte „Strickbauten“ in Stein. Sucht man nach formalen Entsprechungen im Alltag, denkt man zuerst an Tore, aneinandergereihte Fensterstürze oder Regalsysteme. Es handelt sich vielfach um mäander- und zaunartig fortschreitende architektonische Gebilde aus Stützen und Trägern. Sie sind geometrisch exakt herausgearbeitet und aufgrund ihres modularen Charakters größenmäßig beliebig erweiterbar. Kunstsprachlich gesehen wirken die Arbeiten entsprechend reduziert und minimalistisch. Die unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen der „Bauteile“ reizen zwangsläufig den Tastsinn des Betrachters. Einer vom Minimalismus geprägten Formschönheit verpflichtet, gerinnen die den Raum besetzenden skulpturalen Architekturen Meusburgers im übertragenen Sinne auch zu kontemplativen Meditationsstücken.
Der Bergenzerwälder Künstler konzipiert seine Formationen unter Auslotung des sie umgebenden Raumes. Im Dialog von skulpturaler Anordnung und Architektur entfaltet sich eine spezifische Transparenz des Raumes. Vorgegebene abgesteckte Räume mutieren zu skulptural erschlossenen territorialen Zonen – inhouse oder im Freien. Solche „territorialen Eroberungen“ entfalten sich dann am adäquatesten, wenn es dem Künstler durch Kunst-am-Bau-Aufträge ermöglicht wird, aus dem Vollen zu schöpfen und vielteilige Arbeiten zu konstruieren.
Stein-Formate besetzen den öffentlichen Raum
Ein Beispiel dafür stellt das Projekt für das neue Gebäude der Bundeslehranstalt in Bezau dar (2002). Der Entwurf und die Setzung des dafür erarbeiteten modular aufgebauten Granitrasters ist bewusst ambivalent gewählt: Einerseits soll dem stringenten Konzept der Architektur eine Bruchlinie entgegengeworfen werden, andererseits sucht die Skulptur die Korrespondenz und das Zitat zur Geometrie und zur Materialität der Lehranstalt. Das Material der Skulptur, schwarzer Granit, ist in enger verwandtschaftlicher Beziehung zu den Baumaterialien zu sehen, die zur Realisierung des Baues bestimmt wurden, nämlich Beton, Stahl und Glas. Formal gesehen besteht die Skulptur aus vertikal und quer gesetzten Balken, die durch Ein- und Aussparungen, wie man sie von Blockhäusern her kennt, miteinander verbunden werden. In der Art der Reihung und Verzahnung ergibt sich das Bild eines monumentalen quadratischen Granitrasters mit der Seitenlänge von einem Meter. Symbolisch erinnert der sich in das Zentrum der Aula vorschiebende Steinraster an einen überdimensionalen Reißverschluss, der den lichtdurchfluteten Innenraum der Halle für das Außen öffnet und umgekehrt.
Wesentlicher Faktor der Anlage ist – wie auch bei vielen anderen Kunst-am-Bau-Projekten Meusburgers – deren Begeh- und Bespielbarkeit. So kann die Skulptur etwa als Sitz- und Ablagefläche und damit als kommunikative Einrichtung genutzt werden.
Paradigmatisch für das Vorgehen Meusburgers im öffentlichen Raum ist auch der von ihm gestaltete Kreuzweg auf den Hochberg, einer Grünzone der Marktgemeinde Perchtoldsdorf in der Nähe von Wien. Auf dem unmittelbar zum Ort gehörenden Hochberg steht eine barocke Kreuzigungsgruppe. Zu diesem erst vor kurzem restaurierten Ensemble führt ein von Wald gesäumter, stetig ansteigender Weg. Entlang dieses Weges formierte Meusburger 14 Stationen, die formal abstrakt gehalten sind und sämtlich auf der Geometrie der Kreuzform aufsetzen. Als Vorgabe der Ausschreibung musste der Künstler die barocke Kreuzigungsgruppe in das Gesamtkonzept integrieren. Er band sie folglich als Station 12 in sein planerisches Gefüge mit ein. Ansonsten besteht Meusburgers Stationenweg aus Stelen, Quadern und Kreuzen aus afrikanischem Granit sowie aus Implantaten aus Mauthausener Granit, die wie Pflastersteine in den Boden eingelassen sind und Aussparungen aufweisen, durch welche das Gras herauswachsen kann. Der Bildhauer variiert die geometrische Form des Kreuzes in alle Richtungen. Manchmal ist sie auf Anhieb erkennbar, manchmal löst sie sich in Quadrate auf oder sie evoziert Anklänge an inhaltlich vorbelastete Zeichen, wie etwa das Hakenkreuz, auch wenn diese nicht offen zutage treten. Die bis zu zwei Meter großen skulpturalen Anordnungen leben unter anderem durch die unterschiedliche Steinbearbeitung.
Ingesamt besteht Meusburgers Granitstaffette aus 70 Einzelteilen, die zusammen rund zehn Tonnen wiegen.
Als weitere größere Anlagen Meusburgers im öffentlichen Raum ist etwa auf das Katmandu-Tal in Nepal, die Dorfplatzgestaltungen in Krumbach und Bizau, die Platzgestaltung mit einer 30-teiligen Granitskulptur für die Firma DTM in Deutschland oder das Mahnmal Mayr-Nusser am Ritten (Südtirol) zu verweisen.
Dass sich das formale und inhaltliche Konzept Meusburgers in idealer Weise auch im angewandten Bereich fortsetzen lässt, beweisen Arbeiten wie etwa die Totenkapelle in Bizau, die Urnenwand in Mellau oder das Kunst-am-Bau-Projekt im Kunsthistorischen Museum in Wien.
Resümierend lässt sich festhalten, dass sich bei Herbert Meusburger die Archaik des Materials, des Granits, des Serpentins aufgrund seiner konstruktiv-konzeptionellen Verarbeitungsstrategie zu einer autonomen, konstanten materiellen Behauptung auswuchtet. Der von den Arbeiten beschriebene skulpturale Raum wird zu einem Ausrufungszeichen, gesetzt vor dem Hintergrund einer sich rasend beschleunigenden Zeit. Der künstlerische Ort wird zu einem „Haus des Seins“ (Heidegger), zu einem Ort, an dem Wirklichkeit entworfen wird, an dem Sprache und Denken, Handeln und Tun beheimatet sind, zu einem topografischen Punkt, an dem Trennendes und Verbindendes katalysiert werden.
Der Bildhauer als Vermittler
Das Bild vom Künstler Herbert Meusburger wäre unvollständig, führte man nicht auch seine Kunst vermittelnden Aktivitäten an. Und zwar vermittelnd nicht nur in einem betrachterzentrierten Sinne, sondern auch in Bezug auf die Unterstützung der Künstlerkollegenschaft. So ist es ein wesentlicher Charakterzug des Bregenzerwälder Bildhauers, dass er sich seit jeher stark für Ausstellungsmöglichkeiten seiner Künstlerkollegenschaft einsetzt. Mit seinen „Werkstattgesprächen“ in seinem „offenen Atelier“ in Bizau führte er auch viele „Kunstkonsumenten“ in das Wesen der Bildhauerei ein. Nicht zu vergessen, dass er zu Beginn der 1990er Jahre das Bildhauersymposium in Hohenems leitete.
Den Grundstein zu der bislang wirkungsspezifisch wohl wichtigsten Aktion legte er im Sommer des Vorjahres. Am 23. August 2008 wurde unter dem Namen „Galerie 365“ in Schnepfau im Bregenzerwald ein Kunstraum eröffnet, der, wie es schon der Titel verspricht, 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag zugänglich ist. Dieser Ort der Kunst verfolgt das Ziel, internationale Kunst im Bregenzerwald diskursiv verfügbar zu machen.
Architektonisch repräsentiert die Galerie 365 einen aus Stahl, Beton und Holz geformten Pavillon. Die Hängekonstruktion mit Drahtseilen, an der der Kunstraum quasi festgemacht ist, stellt eine sowohl statisch wie optisch markante Zäsur dar. Der solcherart baulich angerissene Ausstellungsraum ist nach zwei Seiten hin offen und damit frei begehbar. Die Offenheit des gebauten Raumes schließt die Möglichkeit mit ein, den Raum optional und beliebig ins Freie zu erweitern und den Umraum des gebauten Raumes in die Ausstellungskonzepte einzubeziehen. Der architektonische Entwurf und die Realisation des Raumes stammen von Beat Wüstner und dessen gleichnamiger Seilerei. Wüstner war es auch, der die Idee zu diesem Kunsthallenkonzept von Beginn an ideell und finanziell mitgetragen hat.
Der in Schnepfau errichtete Kunstraum ist für alle Bewohner und Besucher des Bregenzerwaldes frei zugänglich. Das Betriebskonzept der Galerie birgt durch seine komplette Öffnung nach außen ein immenses Potenzial der Auseinandersetzung. Ein auf hohem Niveau geführtes Inhaltsprogramm soll diese Auseinandersetzung zusätzlich fördern, auch wenn das Konzept in sich durchaus Konfliktstoffe enthält, wie dies bei Kunst im öffentlichen Raum generell der Fall ist.
Die in der Galerie 365 gezeigten Arbeiten entstehen direkt vor Ort in unmittelbarem Dialog mit der Natur, der Landschaft, der Kultur und der Gesellschaft des Bregenzerwaldes.
Um die Ausstellungsqualität langfristig zu sichern, baut Meusburger auf ein Gastkuratorenkonzept. Nach diesem Prinzip soll künftig insbesondere internationale sowie ambitionierte junge Kunst präsentiert werden. Zu diesem Zweck sind auch Kooperationsgespräche etwa mit der Werkstätte Kollerschlag sowie verschiedenen renommierten Kunstinstitutionen im Gange.
Karlheinz Pichler (Kurator und freier Journalist, Zürich)